Welche Hormone gibt es?
Nachfolgend haben wir für
Sie eine Auswahl der wichtigen Hormone beschrieben und tabellarisch
zusammengefasst.
Neurostress Hormone
Adrenalin
Adrenalin zählt zur Gruppe der so genannten Katecholamine. Weitere Katecholamine
sind Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Adrenalin wird im Nebennierenmark und
im sympathischen Nervensystem gebildet. Seine Ausschüttung wird von den Nerven
des sympathischen Nervensystems gesteuert und bei körperlichem oder psychischem
Stress veranlasst (z. B. Infektion, Operation, Angst, Ärger). Adrenalin setzt
der Körper quasi „unter Strom, es bewirkt eine verstärkte Bereitstellung von
Energie, erhöht den Herzschlag und Blutdruck, erweitert Atemwege und Pupillen
und fördert den Sauerstoffverbrauch.
Dopamin
Dopamin zählt auch zu der Gruppe der Katecholamine. Es wird im Mittelhirn im
Hypothalamus und in der Substantia nigra gebildet. Das Nebennnierenmark stellt
aus Dopamin Adrenalin und Noradrenalin her. Dopamin selbst hemmt die Freisetzung
von Prolaktin, und spielt bei vielen motorischen, emotionalen und geistigen
Reaktionen eine Rolle. Darüber hinaus reguliert der Botenstoff die Durchblutung
der Bauchorgane insbesondere der Niere. Ein Dopaminmangel liegt zum Beispiel bei
der Parkinsonschen Krankheit (Schüttellähme) vor. Ein Dopaminmangel kann auch
Ursache der tiefgehenden Erschöpfung (zentrale Fatigue) sein.
Serotonin
Serotonin wird vor allem im Hirnstamm und im Hypothalamus gebildet. Es
vermittelt eine Verengung der Blutgefäße und steigert die Herzfrequenz sowie die
Schlagkraft des Herzens. Außerdem steuert Serotonin im Zusammenspiel mit anderen
Botenstoffen das Gefühlsleben, Schlafrhythmus, Sexualtrieb und die
Körpertemperatur. Serotoninwerte sind häufig bei Erschöpfung, Müdigkeit und
Kraftlosigkeit erniedrigt. Auch vermehrte Schmerzzustände wie Kopfschmerzen und
Migräne lassen sich häufig auf einen Serotoninmangel zurückführen.
Serotoninmangel findet man ebenfalls häufig bei Übergewicht. Patienten mit
Hyperinsulinismus (vermehrten Hunger auf Süßes) zeigen oft einen Serotoninmangel.
Auch Schilddrüsenhormone scheinen unter der Kontrolle des Serotonins zu stehen.
Die Bestimmung des Serotonins wird daher bei Übergewicht angeraten. Eine
gezielte Therapie entweder mit Antidepressiva (wenn notwendig) oder mit
biologischen Vorstufen kann in Abstimmung mit der Laborkontrolle zu guten
Therapieergebnissen beitragen.
Wichtig scheint auch die Erkenntnis zu sein, dass Serotoninvorstufen bei
entzündlichen Darmerkrankungen nur ungenügend aufgenommen werden. Unter diesen
Problemen können auch Patienten gehören die unter einer Fruktoseintoleranz
leiden. Patienten mit Serotoninmangel neigen häufiger zu Migräneattacken und
vermehrten Muskel- und Sehnenschmerzen (Fibromyalgie).
Sexual Hormone
Östrogen
Östrogen und Progesteron sind die weiblichen Geschlechtshormone GnRH (gonadotropin
releasing Hormon), FSH (follikelstimulierende Hormon) und LH (luteinisierendes
Hormon) ihre Steuerungshormone.
Östrogene werden vor allem in den Eierstöcken gebildet, ausserdem im Mutterkuchen
(Plazenta), der Nebennierenrinde und in geringer Menge auch im männlichen Hoden.
Das wichtigste Östrogen ist das Östradiol. Die anderen beiden Östrogene Östron
und Östriol sind weniger effektiv. Die Östrogenspiegel im Blut hängen vom
weiblichen Zyklus und schwanken dementsprechend enorm.
Östrogene entfalten ihre Wirkung an vielen Stellen des Körpers. Sie verursachen
u. a. den Eisprung und induzieren den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut in der
ersten Zyklushälfte. Sie fördern den Transport der Eizelle durch den Eileiter
und beeinflussen die Beschaffenheit der Scheidenschleimhaut und der Sekrete der
Gebärmutter. Weiterhin fördern sie das Brustwachstum. In der Pubertät bewirken
sie die Ausbildung der typischen weiblichen Geschlechtsmerkmale (Brüste, hohe
Stimme und weibliches Behaarungs- und Fettverteilungsmuster). Östrogene
stimulieren die Knochenreifung und hemmen den Knochenabbau. Sie senken den
Cholesterinspiegel und führen zu vermehrter Wassereinlagerung im Gewebe.
Außerdem wirken sie auf das Gehirn und beeinflussen so Stimmung und Verhalten.
Progesteron
Progesteron gehört wie Östrogen zu den weiblichen Geschlechtshormonen.
Progesteron wird vorwiegend in den Eierstöcken und dort im Gelbkörper (Corpus
luteum) und im Mutterkuchen (Plazenta) gebildet. Auch die Nebennnierenrinde
produziert geringe Progesteron-Mengen, bei Erwachsenen beiderlei Geschlechts.
Progesteron ist die „Grundsubstanz“ für viele andere Botenstoffe, wie z. B.
Testosteron, Östrogen, Aldosteron und Kortisol.
Der Progesteronspiegel im Blut hängt von der Zyklusphase ab und unterliegt
dementsprechend enormen Schwankungen. Progesteron ist während der zweiten
weiblichen Zyklushälfte das dominierende Hormon. Es bereitet die Gebärmutter auf
das Einnisten einer befruchteten Eizelle vor. Wenn tatsächlich eine
Schwangerschaft eintritt, sorgt es für ihren Fortbestand und bereitet die
Brustdrüse auf die Milchproduktion und die Milchabgabe vor. Progesteron erhöht
zudem die Basaltemperatur. Das ist die Temperatur, die sofort morgens nach dem
Aufwachen gemessen wird.
Künstlich hergestellte Hormone, die dem Progesteron ähneln, nennt man Gestagene.
Sie werden zur Schwangerschaftsverhütung bei der Anti-Baby-Pille und zur
Therapie einiger hormonproduzierender Tumore eingesetzt.
Bei Frauen vor den Wechseljahren sollte zur Progesteronbestimmung der 22. oder
23. Zyklustag gewählt werden. Die günstigste Tageszeit ist vier bis fünf Stunden
nach dem Aufwachen. Vorher sollte die Frau nicht ihre Brust abgetastet haben.
Progesteronwerte sind häufig in der Menopause erniedrigt und Ursache für viele
Beschwerden. Eine Therapie mit bioidentischen Hormonen kann diesen Mangel
ausgleichen.
Prolaktin
Prolaktin wird in der Hypophyse gebildet. Es steuert bei der Frau nach einer
Geburt den Milcheinschuss in die Brust und indirekt den Menstruationszyklus.
Beim Mann besitzt es Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Seine Ausschüttung wird
durch das Saugen an der Brustwarze sowie über die Steuerungshormone PRL-RH (Prolaktin-Releasing-Hormon)
und PRL-IH (Prolaktin-Inhibiting-Hormon) des Hypothalamus beeinflusst.
Testosteron
Testosteron ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon (Androgen).
Bildungsort sind vor allem die Hoden. Bei Frauen produzieren die Eierstöcke und
die Nebennierenrinde auch geringe Mengen an Testosteron. Produktion und
Ausschüttung des Testosterons werden durch ein Hormon der Hirnanhangsdrüse, dem
luteinisierenden Hormon (LH), gesteuert. Testosteron wird durch Enzyme ab- und
umgebaut. Dabei entstehen unter anderen Androstendion, Androsteron und
Dihydrotestosteron, das wirksamer als Testosteron ist.
Testosteron fördert den Eiweißaufbau. Daraus resultiert ein im Vergleich zur
Frau stärkeres Knochen- und Muskelwachstum beim Mann. Ausserdem senkt Testosteron
den Cholesterinspiegel.
Im männlichen Organismus ist Testosteron für die Entwicklung der
Geschlechtsorgane (Hoden, Prostata, Penis), die Ausbildung der typisch
männlichen Geschlechtsmerkmale (Behaarung, tiefe Stimme, spezifische
Fettverteilung) und die Samenbildung zuständig. Testosteronmangel kann ein Grund
für die zunehmende Gewichtszunahme bei Männern (-> Metabolisches Syndrom) sein.
Das sogenannte metabolische Syndrom geht bei Männern über 40 häufig mit einem
Mangel an Testeron einher.
Bei der Frau bewirkt Testosteron eine allgemeine Vermännlichung (Virilisierung)
und einen gesteigerten Geschlechtstrieb (Libido).
Testosteron wird bei vielen Funktionsstörungen therapeutisch angewendet.
Außerdem dienen Testosteronderivate als Dopingmittel im Sport.
Serotonin wird vor allem im Hirnstamm und im Hypothalamus gebildet. Es
vermittelt eine Verengung der Blutgefäße und steigert die Herzfrequenz sowie die
Schlagkraft des Herzens. Außerdem steuert Serotonin im Zusammenspiel mit anderen
Botenstoffen das Gefühlsleben, Schlafrhythmus, Sexualtrieb und die
Körpertemperatur. Serotonindefizite entstehen häufig bei vermehrter
Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Gereiztheit. Häufig besteht auch ein
Zusammenhang zu Verdauungsstörungen. Durch gezielte Diagnostik undentsprechender
Therapie lassen sich langfristig die Symptome der chronischen Erschöpfung
kompensieren.
Stoffwechsel-Hormone
Insulin
Der vielleicht bekannteste Botenstoff wird in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
aus einem Vorläuferhormon, dem Proinsulin gebildet. Aus Proinsulin entstehen zu
gleichen Teilen C-Peptid und Insulin. Während das C-Peptid keine wesentliche
Bedeutung im Körper hat, besitzt Insulin ein breites und komplexes
Wirkungsspektrum.
Gemeinsam mit Glukagon und dem Wachstumshormon Somatostatin regelt Insulin den
Blutzuckerhaushalt, wobei nur Insulin den Blutzuckerspiegel senken kann. Ein
hoher Blutzuckerspiegel, der meist kurz nach der Nahrungsaufnahme auftritt,
wirkt als wichtigster Stimulus für die Insulinausschüttung. Insulin bewirkt,
dass der Zucker (Glukose), in die Zellen des Körpers aufgenommen wird, wodurch
der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Gleichzeitig beeinflusst Insulin auf
vielfältige Weise die Weiterverarbeitung der Glukose in den Zellen sowie den
Fett- und Eiweißstoffwechsel.
Ein Mangel an Insulin, unabhängig davon, wie er verursacht wurde, resultiert in
einem dauerhaft überhöhten Blutzuckerspiegel. Die Folge ist die Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus). Beim Typ 1-Diabetes liegt ein absoluter Insulinmangel vor,
so dass dem Körper gentechnisch hergestelltes oder tierisches Insulin zugeführt
werden muss. Beim Diabetes mellitus Typ- 2 besteht ein so genannter. relativer
Insulinmangel. Dabei produziert die Bauchspeicheldrüse zwar genügend Insulin,
die Empfangszellen können es aber nicht verwerten (Insulinresistenz). Mitunter
ist in diesen Fällen der absolute Insulin- bzw. C-Peptid-Spiegel sogar erhöht.
Insulin und C-Peptid lassen sich im Blutserum nachweisen. Für einen
Blutzuckertest muss der Patient nüchtern zur Blutprobe kommen, d. h. er darf
zehn bis zwölf Stunden zuvor nichts gegessen oder getrunken haben.
Schilddrüsenhormone
Bei den klassischen Schilddrüsenhormonen handelt es sich um Thyroxin und
Triiodthyronin, sowie um das schwach aktive Schilddrüsenhormon ist
Diiodthyronin.Die Hormone werden an Transporthormone gebunden und als inaktive
Hormone abgegeben Die Hormone werden erst bei Bedarf in freie Hormone
umgebildet..Dabei wird freies T4 (fT4) durch einfache Freisetzung des T4 aus
seiner Eiweißbindung gebildet. Das T3 aktivierende Hormon, die
Thyroxindeiodinasen ist selenabhängig und benötigt Serotonin.
Iodaufnahme in die Schilddrüsenfollikel
Für die Synthese der Schilddrüsenhormone wird Iod benötigt, das mit der Nahrung
in Form von Iodid-Ionen aufgenommen wird. Die Schilddrüse ist auf eine
regelmäßige und ausreichende Iodzufuhr angewiesen.. Der Hypothalamus schüttet
das TRH (Syn. Thyreoliberin oder Thyreotropin-Releasinghormon) aus. TRH regt die
Hypophyse zur Ausschüttung von TSH (Syn. Thyreotropin oder Thyroidea
stimulierendes Hormon) an.
Das TSH der Hypophyse bewirkt eine verstärkte Bildung der Schilddrüsenhormone T3
und T4. Die Schilddrüsenhormone gelangen über die Blutbahn an die Zielzellen und
entfalten dort ihre Wirkung, wobei sie sich ganz ähnlich wie Steroidhormone
verhalten. Über die Blutbahn gelangen die Hormone auch in den Bereich von
Hypothalamus und Hypophyse. Diese können mit speziellen Rezeptoren den T3 und T4
Blutspiegel wahrnehmen.
Beim Gesunden dienen die Schilddrüsenhormone der Aufrechterhaltung einer
ausgeglichenen Energiebilanz des Organismus. Sie ermöglichen, dass der
Stoffwechsel dem jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Im Kindesalter regen
die Hormone die Tätigkeit der Körperzellen aller Organe an. Sie fördern in
diesem Lebensabschnitt das Wachstum.Im Erwachsenenalter haben sie auf die Gewebe
des Gehirns, der Hoden und der Milz keinen Einfluss, in allen anderen Geweben
steigern sie den Stoffwechsel. Die biochemische Wirkung in der einzelnen
Körperzelle ist noch nicht ganz genau geklärt.
Wichtig ist aber, dass die Schilddrüsenhormone auf die Tätigkeit anderer
endokrinen Drüsen einwirken. So fördern sie die Abgabe des Wachstumshormons STH
durch die Hypophyse, greifen in den Glukosestoffwechsel über Steigerung der
Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse ein und regen die Tätigkeit der
Nebenniere, besonders der Nebennierenrinde an. Eine Wechselwirkung mit den
Sexualhormonen ist ebenfalls bekannt.
Liothyronin wird manchmal bei der Therapie der Unterfunktion in Kombination mit
Thyroxin verschrieben, zum Beispiel wenn der Patient nicht genügend eigenes T3
aus dem Thyroxin bildet.
Somatostatin
Somatostatin wird im Hypothalamus und in bestimmten Zellen der
Bauchspeicheldrüse gebildet. Es gehört zu den Steuerungshormonen und hemmt die
Ausschüttung des Wachstumshormons (Somatotropin), von TSH (Steuerungshormon der
Schilddrüse), von ACTH (Steuerungshormon u. a. für Kortisol), von Insulin und
Glukagon. Außerdem bremst es die Sekretion von Magensaft sowie die Beweglichkeit
des Magens und des Darmes
Nachweismethoden für Hormone
Hormone lassen sich im Blutserum und im Urin sowie im Speichel nachweisen. Da
Hormone eine starke Wirkung haben, sind sie in äusserst geringen Konzentrationen
im Blut vorhanden. Deshalb braucht man sehr empfindliche Untersuchungsmethoden (Immunoassay
und Radioimmunoassay). Aber nicht die geringen Hormonkonzentrationen im Blut
macht die Hormonbestimmung problematisch. Die vorhandenen Hormonmengen schwanken
zudem stark.
Sie können sich im Jahresrhythmus (Testosteron beim Mann), im Monatsrhythmus
(Östrogen bei der Frau), im Tagesrhythmus (Kortisol) oder sogar im
Stundenrhythmus (follikelstimulierendes Hormon) ändern. Je nach dem Muss man bei
den Hormonbestimmungen Zeiten und Untersuchungsabstände sehr genau einhalten,
denn sonst erhält man keine zuverlässige Aussage
Außerdem bleiben Hormone nur eine begrenzte Zeit im Blut erhalten, denn sie
werden durch Enzyme oder Wärme sehr rasch abgebaut. Deshalb muss bei manchen
Hormonen (ACTH, Parathormon,Calcitonin) die Blutprobe schon während der Abnahme
gekühlt oder ein Enzymhemmer zugegeben werden.
Um die genaue Ursache einer Hormonstörung zu finden, reicht es oft nicht aus,
nur die direkt wirkenden Hormone zu bestimmen. Auch die Steuerungshormone müssen
mit in die Untersuchung eingeschlossen werden.
Neue Labormethoden haben es nun aber ermöglicht das Hormonprofil exakt zu
bestimmen und einen eventuellen Hormonmangel oder eine Störung des
Zusammenspiels der Hormone festzustellen. Diese Untersuchungen sind aus Urin-,
Speichel oder Blutuntersuchungen ohne grösseren Aufwand verlässlich bestimmbar
und werden von uns im Blood- bzw. Urinspottechnik (ggf. auch im Salivaspot)
angeboten. Dabei handelt es sich um eine empfindliche Methode die weniger von
äußeren Einflussfaktoren wie z.B. dem Probentransport abhängt. Bei dieser
Testmethode handelt es sich um eine Weltneuheit die nur von bestimmten
Laboratorien angeboten wird.
Die entsprechende Therapie kann je nach Befund auch durch natürliche sogenannte
bio-identische Hormone durchgeführt werden, die entweder lokal auf die Haut
aufgetragen oder eingenommen werden. Bei solchen natürlichen Hormonen ist die
Gefahr der Nebenwirkungen möglicherweise reduziert.
Im Hormonprofil lässt sich ebenfalls durch eine einfache Urinuntersuchung der
Östrogenmetabolismus kontrollieren. Diese Testmethode gibt laut einer großen
wissenschaftlichen Studie Auskunft über das individuelle Brustkrebs-Risiko für
eine Hormonersatztherapie. Diese Methode ersetzt jedoch nicht der notwendigen
Gesundheitskontrolle bei einem Frauenarzt.
Chirurgie | Hormonsprechstunde | Sprechstunde Metabolisches Syndrom | Prophylaktische Medizin | Neurologie
ÄsthetischeMedizin | Rückenschmerztherapie | Biomedizin | Orthopädische Chirurgie/Sportmedizin | FitnessMedizin
FachaerzteZentrum.ch | Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern | Tel. 041 410 15 09 | Fax 041 410 95 66
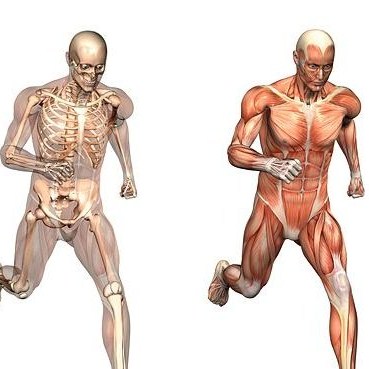


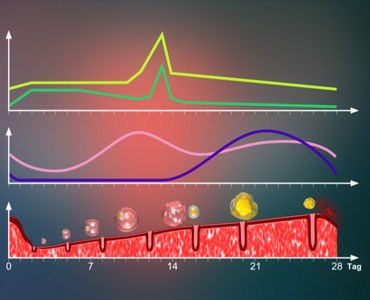


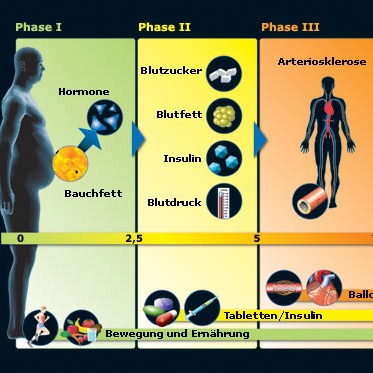


.jpg)