Traumatologie
> Arthrose
Sportmedizin
Hüftarthrose

Der Begriff “Hüftgelenksarthrose/ Hüftarthrose“ (= Koxarthrose oder auch Coxarthrose) umfasst alle degenerativen Erkrankungen im Bereich des Hüftgelenkes, die durch Erkrankung (z.B. angeborene Störung der Funktionseinheit Hüftkopf – Hüftpfanne oder Durchblutungs-, bzw. Stoffwechselstörungen, ...), Unfall (z.B. Schenkelhalsbruch) oder Verschleiß hervorgerufen werden.
Allen ursächlichen Erkrankungen gemein ist eine zunehmende Zerstörung des
Gelenkknorpels, die letztlich auch weitere Gelenkstrukturen wie
Gelenkkapsel, Knochen und die zughörige Muskulatur schädigt und eine
Hüftarthrose bewirkt.
Hüftschmerzen
Sie sind auf der Suche nach der Ursache für Ihre Hüftschmerzen oder Sie
wissen nicht genau, was Ihre Hüftschmerzen verursacht?
Dann lassen Sie sich durch unsere Diagnostikum Hüftschmerzen leiten und
kommen Sie zur wahrscheinlichsten Diagnose.
Alter
In Fällen, bei denen die Ursache der Hüftgelenksarthrose unbekannt ist (=
primäre Hüftarthrose) entwickelt sich eine Hüftgelenksarthrose in der Regel
erst im höheren Lebensalter (Malum coxae senile), somit meist erst nach dem
50.-60. Lebensjahr.
Häufig umfasst die Arthrose beide Seiten des Hüftgelenkes.
Hüftgelenksarthrosen, die auf nicht vollständig ausgeheilten
Hüftgelenkserkrankungen oder anatomischen Varianten im Hüftkopf oder
Pfannenbereich beruhen (= sekundäre Hüftarthrose), treten in der Regel
früher auf und beziehen sich meist nur auf eine Seite des Hüftgelenks.
Medizinisch bezeichnet man den einseitigen Gelenkbefall als monoartikulär.
Geschlechtsverteilung
Da Frauen häufiger unter einer Hüftdysplasie leiden und der Knorpel aufgrund
seiner Beschaffenheit weniger belastbar ist als der männliche Knorpel,
neigen Frauen eher zu Hüftarthrose als Männer.
Häufigkeit
Da letztlich der Verschleiß als Auslöser für die Hüftarthrose als Ursache
gesehen werden muss, erscheint es nicht überraschend, dass das Risiko an
einer Hüftgelenksarthrose zu erkranken mit zunehmendem Lebensalter steigt.
Studien belegen, dass ab einem Alter von 70 Jahren etwa 70 bis 80 %
Verschleisserscheinungen an der Hüfte und/oder anderen Gelenken aufweisen.
Ein wesentlicher Risikofaktor zur Entstehung, bzw. zur Beschleunigung einer
bestehenden Hüftarthrose ist das Übergewicht (Adipositas).
Risikofaktoren
-
Übergewicht: Übergewicht wirkt verschlimmernd auf die oben genannten präarthrotischen Veränderungen. Somit wird das Auftreten einer Hüftarthrose durch Übergewicht erhöht. Sofern bereits eine Arthrose im Hüftgelenk vorliegt, wirkt das Übergewicht in der Regel Schmerz verstärkend. Übergewicht wirkt verschlimmernd, stellt allerdings keine Ursache isolierte dar und ist somit nicht alleinig arthroseerzeugend.
-
Fehlbelastungen, die beispielsweise in Folge schlecht angelegter Hüftpfannen (Hüftdysplasie), ungünstiger Schenkelhalswinkel (Coxa valga antetorta), etc. entstehen.
-
endokrine Faktoren (hormonell bedingte Faktoren), z.B. ein cortisonproduzierender Tumor
-
genetische Einflüsse, familiäre Häufung von Hüftarthrose durch vererbte Hüftdysplasie und Knorpelqualität

Diagnose
Diagnose Hüftarthrose anhand der Röntgenaufnahme
Was sollte untersucht werden, um eine Hüftgelenksarthrose zu diagnostizieren?
Klinische Diagnostik:
-
Beurteilung von Bewegungsumfang und Bewegungsschmerz
-
Beurteilung des Gangbildes
-
Beinlängendifferenz
-
Muskelatrophie
-
Beurteilung druckschmerzhafter Punkte
-
Beurteilung benachbarter Gelenke
-
Beurteilung von Durchblutung, Motorik und Sensibilität
Apparative Diagnostik:
-
Röntgenbild: Beckenübersichtsaufnahme (BÜS)
-
Röntgenbild: axiale / seitliche Aufnahme
-
Röntgen: Funktionsaufnahmen und Spezialprojektionen
-
Sonographie (Ultraschall)
-
Computertomographie (CT)
-
Magnetresonanztomographie (MRT / NMR)
-
Szintigraphie
-
Klinisch-chemisches Labor zur Differentialdiagnostik
-
Punktion mit Synovialanalyse (feingewebliche Untersuchung der Gelenkschleimhautzellen)
In der Regel beschränkt sich eine Arthrose auf ein oder mehrere Gelenke,
wobei sie in den meisten Fällen zunächst über Jahre hinweg symptomfrei
verläuft. Auch wenn man eine Koxarthrose, also den Verschleiß des
Hüftgelenkes bereits auf dem Röntgenbild diagnostizieren kann, sind
Schmerzen oder schmerzbedingte Bewegungseinschränkungen usw. nicht
zwangsläufig vorhanden.
Krankheitsspezifisch steht zunächst die zunehmende Zerstörung des
Hüftgelenkes im Vordergrund. Es treten erste Risse im Gelenkknorpel auf, die
sich zunehmend erweitern und in Folge durch kleine absterbende
Knorpelabriebpartikel eine Gelenkhautentzündung (Synovitis) auslösen. Sie
ist es, die dann beim Patienten teilweise sehr starke Schmerzen verursacht.
Eine Arthrose alleine ist nicht schmerzhaft! Durch den zunehmenden Druck,
der auf dem Gelenk lastet versucht dasselbe en Druck durch eine größere
Gelenkfläche zu vermindern. Dadurch kommt es zu Knochenanbauten. Die
Konsequenzen der Veränderungen durch Zerstörung und Verformung im Bereich
der Hüftpfanne sowie Kapselschrumpfung und Knochenanbau schlägt sich in
einer schmerzhaften Funktionsminderung nieder.
Das Röntgenbild weist einen aufgebrauchten Gelenkknorpel auf, den man durch
das Nichtvorhandensein eines Gelenkspaltes erkennt. Die Veränderungen werden
besonders dann deutlich, wenn man sie mit dem Röntgenbild einer gesunden
Hüfte (siehe oben) vergleicht.
Prognose
1. Natürlicher Verlauf
Der Verlauf einer Hüftarthrose unterliegt vieler Variablen, die es nicht
erlauben für den Einzelfall eine exakte Prognose zu stellen:
Der individuelle Verlauf
Die vielfältigen Ursachen einer Hüftarthrose, die darüber hinaus nicht immer
eindeutig definiert werden können.
Es kann daher keine wissenschaftlich exakte Prognose im Hinblick auf den
Krankheits- und Schmerzverlauf, der eventuellen Notwendigkeit konservativer
oder operativer Therapien gegeben werden.
Fest steht allerdings, dass der Arthrosegrad mit der Dauer der Erkrankung
zunimmt.
2. Prognose nach bestimmten therapeutischen Verfahren
Umstellungsosteotomie / Korrekturosteotomien
Hierbei wird in erster Linie eine Druckreduzierung herbeigeführt. Wichtig zu
erwähnen ist jedoch, dass mit zunehmendem Arthrosestadium und Alter die
Erfolgschancen dieser Operationsverfahren sinken. Mehr hierzu erfahren Sie
weiter unten im Text.
Hüftendoprothetik
Der erfolgswahrscheinlich nach Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes
liegt sehr hoch eine vollständige Beschwerdefreiheit zu erreichen.
Die Wechselrate, das heisst der Austausch vom Komponenten des Hüftgelenkes,
liegt bei ca. 0,5% pro Jahr, nach 10-15 Jahren steigt die jährliche
Wechselrate an.
Chirurgie | Hormonsprechstunde | Sprechstunde Metabolisches Syndrom | Prophylaktische Medizin | Neurologie
ÄsthetischeMedizin | Rückenschmerztherapie | Biomedizin | Orthopädische Chirurgie/Sportmedizin | FitnessMedizin
FachaerzteZentrum.ch | Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern | Tel. 041 410 15 09 | Fax 041 410 95 66
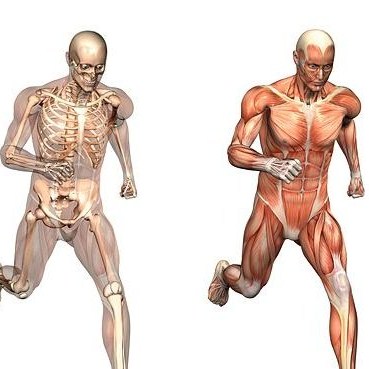


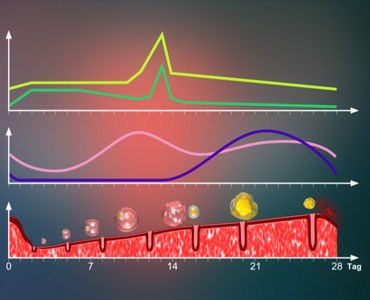


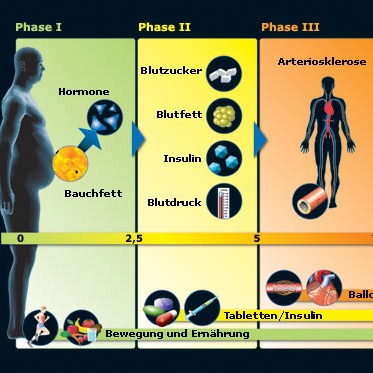


.jpg)